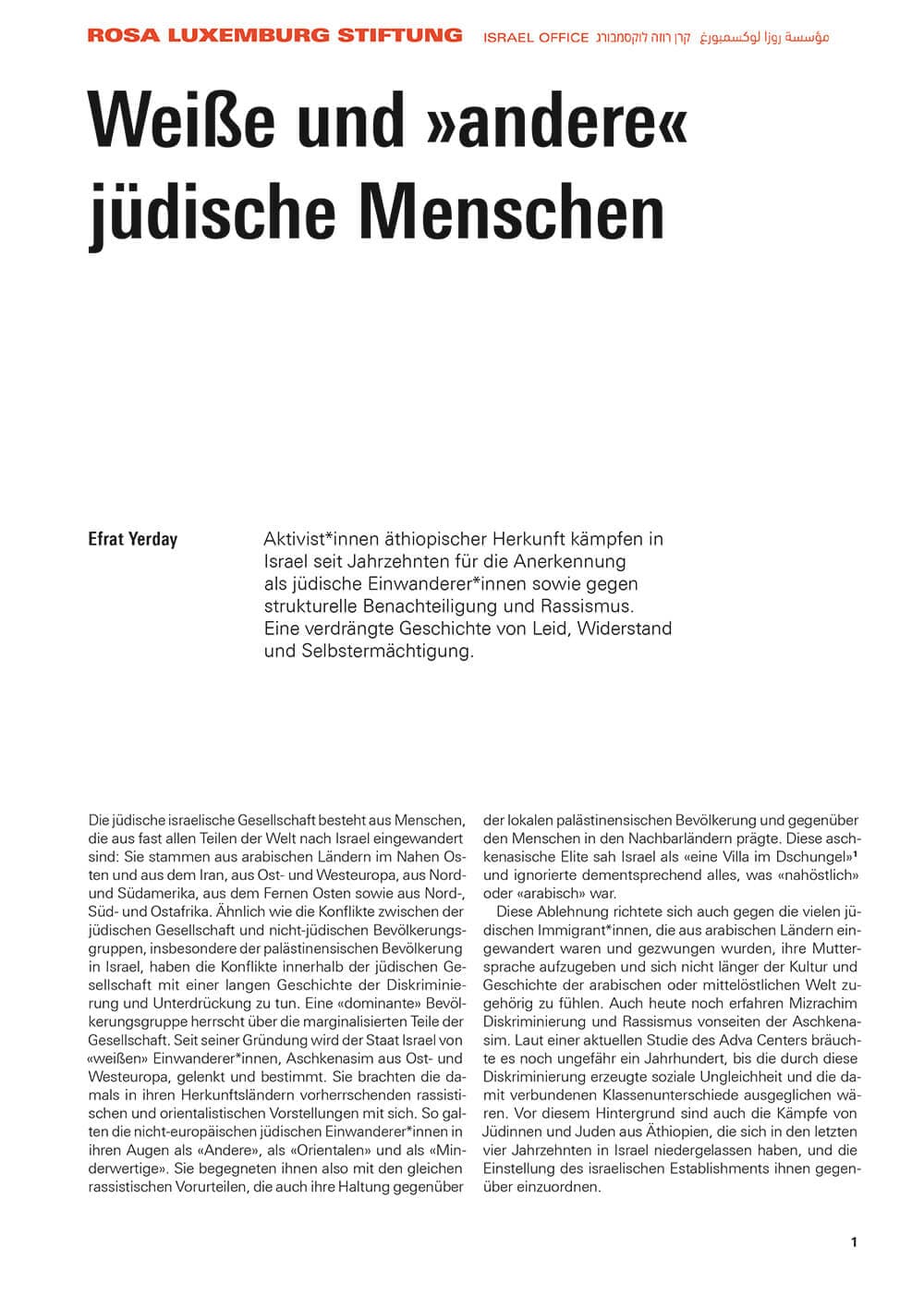Weiße und "andere" jüdische Menschen
Aktivist*innen äthiopischer Herkunft kämpfen in Israel seit Jahrzehnten für die Anerkennung als jüdische Einwanderer*innen sowie gegen strukturelle Benachteiligung und Rassismus. Eine verdrängte Geschichte von Leid, Widerstand und Selbstermächtigung.
Die jüdische israelische Gesellschaft besteht aus Menschen, die aus fast allen Teilen der Welt nach Israel eingewandert sind: Sie stammen aus arabischen Ländern im Nahen Osten und aus dem Iran, aus Ost- und Westeuropa, aus Nord- und Südamerika, aus dem Fernen Osten sowie aus Nord-, Süd- und Ostafrika. Ähnlich wie die Konflikte zwischen der jüdischen Gesellschaft und nicht-jüdischen Bevölkerungsgruppen, insbesondere der palästinensischen Bevölkerung in Israel, haben die Konflikte innerhalb der jüdischen Gesellschaft mit einer langen Geschichte der Diskriminierung und Unterdrückung zu tun. Eine «dominante» Bevölkerungsgruppe herrscht über die marginalisierten Teile der Gesellschaft. Seit seiner Gründung wird der Staat Israel von «weißen» Einwanderer*innen, Aschkenasim aus Ost- und Westeuropa, gelenkt und bestimmt. Sie brachten die damals in ihren Herkunftsländern vorherrschenden rassistischen und orientalistischen Vorstellungen mit sich. So galten die nicht-europäischen jüdischen Einwanderer*innen in ihren Augen als «Andere», als «Orientalen» und als «Minderwertige». Sie begegneten ihnen also mit den gleichen rassistischen Vorurteilen, die auch ihre Haltung gegenüber der lokalen palästinensischen Bevölkerung und gegenüber den Menschen in den Nachbarländern prägte. Diese aschkenasische Elite sah Israel als «eine Villa im Dschungel»[1] und ignorierte dementsprechend alles, was «nahöstlich» oder «arabisch» war.

Diese Ablehnung richtete sich auch gegen die vielen jüdischen Immigrant*innen, die aus arabischen Ländern eingewandert waren und gezwungen wurden, ihre Muttersprache aufzugeben und sich nicht länger der Kultur und Geschichte der arabischen oder mittelöstlichen Welt zugehörig zu fühlen. Auch heute noch erfahren Mizrachim Diskriminierung und Rassismus vonseiten der Aschkenasim. Laut einer aktuellen Studie des Adva Centers bräuchte es noch ungefähr ein Jahrhundert, bis die durch diese Diskriminierung erzeugte soziale Ungleichheit und die damit verbundenen Klassenunterschiede ausgeglichen wären. Vor diesem Hintergrund sind auch die Kämpfe von Jüdinnen und Juden aus Äthiopien, die sich in den letzten vier Jahrzehnten in Israel niedergelassen haben, und die Einstellung des israelischen Establishments ihnen gegenüber einzuordnen.
Verdrängte Narrative: Die Geschichte einer Familie und die Geschichte der äthiopischen Jüdinnen und Juden
Mein Vater kam 1970 nach Israel, während meine Mutter und meine ältere Schwester, die damals ein Jahr alt war, zunächst in Äthiopien blieben. Er migrierte nach Israel, nachdem er drei Jahre lang in Asmara in Eritrea (das damals zu Äthiopien gehörte) verbracht hatte. Dort hatte er in einer israelischen Fleischfabrik gearbeitet und seine Ausreise nach Israel vorbereitet. Er fuhr mit einem Schiff von der eritreischen Hafenstadt Massaua nach Eilat und reiste in Israel als Tourist ein, weil zu jener Zeit das Rückkehrgesetz [Begriffserklärung siehe Glossar] nicht für Falaschen galt, wie äthiopische Jüdinnen und Juden damals genannt wurden.[2] Drei Jahre später ist das israelische Innenministerium auf meinen Vater und vier seiner Freunde, die auf ähnliche Weise ins Land gekommen waren, aufmerksam geworden. Es ordnete ihre Abschiebung aus Israel an. Zu dieser Zeit hatte sich mein Vater mit dem Aktivisten Chezi Ovadja, einem Mitbegründer der Organisation Öffentliches Hilfskomitee für die Falaschen, angefreundet. Die beiden trafen den sephardischen Oberrabbiner Ovadja Josef und überzeugten ihn davon, sich für das Recht auf Einwanderung von Jüdinnen und Juden aus Äthiopien einzusetzen. Nach dem Treffen wurde die Abschiebungsanordnung ausgesetzt und später gänzlich aufgehoben.
Gleichzeitig bemühte sich mein Vater darum, meine Mutter und meine Schwester nach Israel nachzuholen. Sowohl mein Vater als auch meine Mutter mussten deswegen die äthiopischen Behörden anlügen: Mein Vater behauptete, er wolle nach Israel gehen, um dort lediglich temporär zu arbeiten, und meine Mutter sagte, dass sie und meine Schwester meinen Vater in Israel nur besuchen wollten und bald darauf zurückkehren würden. Im Jahr 1973 waren sie wieder vereint und konnten zusammen in Israel leben, nachdem das Innenministerium unter der Leitung von Josef Burg von der Abschiebung meines Vaters Abstand genommen hatte. Beide meiner Eltern wurden in ihrer neuen Heimat zu politischen Aktivist*innen für die Rechte von Migrant*innen. Ihre Wohnung entwickelte sich zu einem wichtigen Treffpunkt, zu einer Art Hauptquartier für den Kampf der Äthiopier*innen um ihre Rechte in Israel.
Die persönliche Geschichte meiner Eltern ist Teil der allgemeinen Geschichte der Einwanderung von Jüdinnen und Juden aus Äthiopien nach Israel. Es gab schon immer eine enge Verbindung zwischen den Juden in Äthiopien und der jüdischen Diaspora. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts versuchten jüdische Menschen in Äthiopien das erste Mal in größerer Zahl nach Palästina auszuwandern. Dann in den 1930er Jahren kamen viele gemeinsam mit jemenitischen Jüdinnen und Juden aus dem von Italien besetzen Eritrea nach Palästina. Doch nach der Staatsgründung wurde ihnen die Einwanderung mit der Begründung verwehrt, es sei zweifelhaft, ob sie wirklich jüdisch seien. Aus einem Dokument der Einwanderungsbehörde, der Jewish Agency, aus jener Zeit geht hervor, dass der ablehnenden Haltung des Staats die Befürchtung zugrunde lag, dass eine solche Einwanderung zu «Rassenproblemen» und zu großen «kulturellen Unterschieden» führen könne.
Das Bestreben Israels, eine «weiße» Nation zu sein, und damit die rassistischen Vorbehalte gegen die Ansiedlung äthiopischer Jüdinnen und Juden, gehörten zur offiziellen staatlichen Politik. Die ersten israelischen Premierminister*innen, David Ben-Gurion, Mosche Scharett und Golda Meir, waren gegen die Einwanderung aus Äthiopien und forcierten stattdessen aus demografischen Gründen die Migration aus muslimischen Ländern und aus Osteuropa, um den Anteil der jüdischen Bevölkerung gegenüber den Araber*innen zu erhöhen (was bis heute ein zentrales staatliches Anliegen ist).
In den 1960er Jahren wandten sich die Aktivist*innen an den Jüdischen Weltkongress[3] und baten ihn um Unterstützung für Migrant*innen aus Äthiopien und benachbarten Ländern. Der Kongress gründete den Wohlfahrtsverband für Falaschen, der sich in der Bildungsarbeit in Äthiopien engagierte. Unter anderem versuchte er, die Menschen dort von ihrem Plan, nach Israel auszuwandern, abzubringen. Zur gleichen Zeit verbot das israelische Innenministerium, äthiopischen Jüdinnen und Juden ohne ein im Voraus erteiltes Visum nach Israel einzureisen. Trotz der Einreisebeschränkungen kamen jedoch weitere Jüdinnen und Juden aus Äthiopien nach Israel, nun «getarnt» als Christ*innen.
Wie bereits am Beispiel meines Vaters beschrieben, kündigte 1973 das israelische Innenministerium an, Mitglieder der jungen äthiopischen jüdischen Community abzuschieben, mit der Begründung, dass sie keine Jüdinnen und Juden nach dem (orthodoxen) jüdischen Recht seien und daher das Rückkehrgesetz auf sie nicht anwendbar sei. Wie erwähnt, fanden sie Unterstützung bei Chezi Ovadja, einem Aktivisten jemenitischer Herkunft, der in Äthiopien als Sohn des Oberrabbiners in Asmara aufgewachsen war. Er half, den von Abschiebung Bedrohten sich zu verstecken, und wandte sich an den sephardischen Oberrabbiner Ovadja Josef, um eine Bleiberecht für sie zu erwirken. Dieser setzte sich gegen die Abschiebung ein, verlangte aber von den Betroffenen, dass sie pro forma zum Judentum konvertierten, um sicherzustellen, dass sie tatsächlich Jüdinnen und Juden waren. Obwohl sie im Rabbinat fortan anerkannt waren, dauerte es noch vier Jahre, also bis 1977, bis das Innenministerium nachzog und das Rückkehrgesetz auch auf Juden aus Äthiopien (Beta Israel) angewendet wurde. Doch dieses Zugeständnis währte nicht lange: Mit dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und Äthiopien ging eine Unterbindung weiterer Einwanderung einher.

Dieses frühe Kapitel in der Geschichte der äthiopischen Juden in Israel ist nur wenigen Menschen bekannt und es taucht auch nicht im Schulunterricht und in den Geschichtsbüchern auf. Der israelische Staat ist (wie jede Nation) daran interessiert, eine bestimmte Version der Geschichte zu erzählen, eine Version, die seine Position und Handlungen rechtfertigt und die Bürger*innen an sich bindet. Die Geschichte der Einwanderung aus Äthiopien (wie andere Geschichten auch) wird auch heute noch vor unseren Augen umgeschrieben. Die offizielle Lesart erzählt – gelinde gesagt – nur einen kleinen Teil der Geschichte dieser Einwanderung. Für den Staat und die meisten in Israel Lebenden beginnt die Einwanderung aus Äthiopien mit der heroischen «Operation Moses» in den 1980er Jahren, als in Äthiopien Bürgerkrieg und eine große Hungersnot herrschten. Damals – zwischen Dezember 1984 und Januar 1985 – wurden Tausende äthiopische Jüdinnen und Juden aus Flüchtlingslagern im Sudan in einer Geheimaktion nach Israel gebracht.
Gegen das Ignorieren: Der lange Kampf um die Anerkennung der äthiopischen Jüdinnen und Juden
Wie oben beschrieben, lebten schon lange vor der «Operation Moses» viele äthiopische Juden in Israel und kämpften darum, vom israelischen Staat und von der israelischen Gesellschaft als legitime Einwanderer*innen anerkannt zu werden. Die langjährige Weigerung vonseiten der israelischen Politik, dieses Anliegen und die prekäre Lage der jüdischen Bevölkerung in Äthiopien wahrzunehmen, verzögerte deren Auswanderung und bedeutete letztlich, dass viele in den Flüchtlingslagern im Sudan und im Bürgerkrieg in Äthiopien den Tod fanden.
Es war nur deshalb möglich, das Leid der äthiopischen Jüdinnen und Juden zu ignorieren, weil sie nicht als Teil des jüdischen Kollektivs gesehen wurden. Der 1973 veröffentlichte Litvak-Bericht steht stellvertretend für die Haltung des damaligen Establishments gegenüber den äthiopischen Juden und markiert einen politisch-moralischen Tiefpunkt im Umgang mit Migration. In dem vom für Einwanderung zuständigen Ministerium in Auftrag gegebenen Bericht erklärte der Autor, Dr. Joseph Litvek, dass die aus Äthiopien Stammenden nicht wirklich jüdisch und «zu primitiv für unser fortschrittliches Land» seien. Von daher sei es besser für sie, wenn sie in Äthiopien blieben, unter «Menschen, die ihnen ähnlich sind». Mit dieser Einstellung wurden in den 1970er Jahren bürokratische Hürden aufrechterhalten, um jüdische Äthiopier*innen vom Recht auf Niederlassung in Israel auszuschließen.
Als das Rückkehrgesetz 1977 endlich auch für sie zur Anwendung kam, brachen die diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und Äthiopien ab und von den Aktivist*innen in Israel wurde aus «Gründen der inneren Sicherheit» verlangt, ihre politisches Engagement einzustellen. Aber im Januar 1979 hielten sie es nicht mehr aus, untätig zu bleiben, und so kam es zu einer historischen Demonstration vor dem Büro des Premierministers. Zeitgleich baute sich internationaler Druck auf. Gemeinsam mit dem jahrzehntelangen Kampf der Aktivist*innen vor Ort führte dies zu einer Änderung der Einstellung der israelischen Regierung gegenüber äthiopischen Jüdinnen und Juden. Erstmals ging der israelische Staat auf deren Forderungen ein und bereitete sich darauf vor, äthiopische Jüdinnen und Juden aus Flüchtlingslagern zu evakuieren und nach Israel zu bringen.
Das israelische Bildungsministerium zieht es bis heute vor, in den Geschichtsbüchern so zu tun, als habe die Einwanderung von äthiopischen Jüdinnen und Juden erst Mitte der 1980er Jahre begonnen. In der offiziellen Darstellung wird sich zudem darauf konzentriert, wie Mossad-Agent*innen äthiopische Juden aus Flüchtlingslagern mitten in der Wüste geschmuggelt haben, wobei Bilder von den Äthiopier*innen als halb verhungerte Flüchtlinge und von den Israelis als vorbildliche heroische Soldat*innen und Retter*innen dominieren. Jedoch sollte nicht vergessen werden, dass diese Mossad-Agent*innen erst zum Einsatz kamen, nachdem das Schicksal der äthiopischen jüdischen Menschen in Israel jahrzehntelang ignoriert worden war. Erst der hartnäckige Kampf der äthiopischen Aktivist*innen in Israel zusammen mit der Zunahme des internationalen Drucks und der Bemühungen von Hilfsorganisationen, wie zum Beispiel der US-amerikanischen Vereinigung für äthiopische Juden, haben hier ein Umdenken in der Politik herbeigeführt. Zugleich verschlechterte sich die Situation der Menschen in den Flüchtlingslagern im Sudan. Am Ende war das Zusammenwirken von äußerem und innerem Druck entscheidend. Bis heute jedoch werden die Bewegung der äthiopischen Aktivist*innen in Israel, ihre Kämpfe und die internationale Solidarität, die sie erfuhren, von der offiziellen Geschichtsschreibung in Israel nicht zur Kenntnis genommen.
Und die Einwanderer*innen selbst? Jene Menschen, die irgendwann beschlossen haben, Äthiopien zu verlassen und für immer nach Israel zu gehen, die sich dem jüdischen Volk zugehörig fühlen und Israel als ihre Heimat sehen? Dass der Staat ihnen lange Zeit abgesprochen hat, jüdisch zu sein, hat eine tiefe Krise in der Community ausgelöst, die ihre Identität untergrub und unter deren Auswirkungen die äthiopischen Jüdinnen und Juden bis heute leiden. Dass sie derart diskriminiert und verleugnet wurden, muss mit ihrer Hautfarbe zusammenhängen. Der israelische Staat, dessen religiöse Institutionen von der orthodoxen Strömung[4] beherrscht werden, bemüht sich seit seiner Gründung um ein «weißes Gesicht». Israel versucht, «Teil von Europa» zu sein, entsprechend schwer fällt es dem Staat, die Existenz von schwarzen Jüdinnen und Juden zu akzeptieren.
Dass «Schwarzsein» nicht mit «Jüdischsein» vereinbar sein soll, ist etwas, womit die äthiopische Community erstmals in der «weißen» israelischen Gesellschaft konfrontiert wurde. Vor ihrer Auswanderung nach Israel haben die Menschen die Erfahrung gemacht, als Jüdinnen und Juden diskriminiert zu werden, in Israel ist der Grund für ihre Diskriminierung ihr Schwarzsein. Damit stehen die äthiopischen Einwanderer*innen vor der für sie neuen Herausforderung, sich gegen einen in Israel weit verbreiteten Rassismus zur Wehr setzen zu müssen.
Rassistische und diskriminierende Praktiken dauern bis heute an
In Israel gibt es freilich keine Gesetze, die verbieten, dass Menschen verschiedener «Rassen» einander heiraten, und es gibt keine Gesetze, die die Trennung von «Schwarzen» und «Weißen» im Bus vorschreiben. Trotzdem lässt sich schwerlich übersehen, dass es im Land einen institutionellen Rassismus gibt, der zwischen den äthiopischen Einwanderer*innen und ihren Nachkommen sowie der übrigen israelischen Gesellschaft unterscheidet.
Die jahrzehntelange Weigerung des israelischen Staats, die Existenz schwarzer Juden anzuerkennen und ihnen das Recht auf Einwanderung zuzugestehen, wurde bereits beschrieben. Aber auch nachdem man sie offiziell ins Land ließ, setzte sich die Sonderbehandlung fort. So haben staatliche Stellen äthiopische Familien auseinandergerissen, mit der Begründung, die Eltern wüssten nicht, was gut für ihre Kinder ist. Um die Kinder in das neue israelische Judentum «zu integrieren», hat sich der Staat bemüht, sie in Internaten der national-religiösen Bewegung[5] unterzubringen, die für diesen Zweck enorme finanzielle Zuwendungen erhielten. Heute noch brüsten sich Vertreter*innen des religiösen Zionismus damit, die einzige Strömung gewesen zu sein, die eingewilligt habe, äthiopische Kinder in ihren Bildungseinrichtungen aufzunehmen.
In diesem Prozess wurde außerdem die Autorität der äthiopischen Religionsgelehrten zugunsten des in Israel vorherrschenden orthodoxen Judentums untergraben. Die in Israel dominanten Gruppen sorgten dafür, dass andere Erfahrungen und Formen des Judentums, vom Schtetl[6] in Polen bis hin zum Dorf in Äthiopien, die bereits vor der Staatsgründung Israels bestanden hatten, an Bedeutung verloren und marginalisiert wurden. Des Weiteren gehört zur Sonderbehandlung von Einwanderer*innen aus Äthiopien der Zwang, längere Zeit in staatlichen Aufnahmezentren zu wohnen. Diese Internierungspflicht bestand nur für äthiopische Juden, alle anderen Einwanderer*innen durften sich die Art der Unterkunft aussuchen. Auch heute noch müssen Neuzugewanderte aus Äthiopien mit einem mindestens zweijährigen Aufenthalt in einem solchen Aufnahmezentrum rechnen. Während dieser Zeit müssen sie ein vom Staat vorgegebenes Programm durchlaufen, um offiziell zum Judentum zu konvertieren.
Wie so oft nimmt auch die institutionelle Diskriminierung in Israel immer raffiniertere Formen an. Damit reagiert der Staat nicht zuletzt auf die zunehmende öffentliche Kritik und die Proteste der äthiopischen Einwanderer*innen. Ein Ansatz, die äthiopischen Migrant*innen zu diskriminieren und ihre Integration zu verzögern, besteht darin, sie systematisch vom Rest der israelischen Gesellschaft zu isolieren. So wird ihnen zum Beispiel nur dann ein Zuschuss zum Kauf einer Wohnung vonseiten des Einwanderungsministeriums gewährt, wenn sich die Wohnung in bestimmten, vom Ministerium festgelegten Städten oder Straßen befindet. Bei allen anderen Einwanderergruppen wird dieser Zuschuss unabhängig von der Lage der Wohnung gewährt. Auch die Einwanderungsquoten, die der Staat in den letzten zehn Jahren eingeführt hat, nachdem Menschen, die als Falaschamura bezeichnet werden, das Recht abgesprochen wurde, aufgrund des Rückkehrgesetzes aus Äthiopien nach Israel einzuwandern[7], sind beispiellos und erschütternd. Äthiopien ist das einzige Land, für das der israelische Staat monatliche Einwanderungsquoten festgelegt hat.
Da äthiopische Einwanderer*innen bevorzugt in bestimmte Stadtviertel ziehen und ihre Kinder in die nahegelegenen Schulen schicken, gibt es in Israel inzwischen Schulen mit ausschließlich äthiopischen Schüler*innen. Diese Schulen werben zum Beispiel von US-amerikanischen Juden viele Spenden ein, indem sie Fotografien von Schüler*innen zu Werbezwecken verwenden, auf denen diese in einer exotisierenden, orientalistischen und rassistischen Weise dargestellt sind. Das heißt, die besondere Situation von Menschen äthiopischer Herkunft in Israel wird zum Teil für wirtschaftliche Interessen instrumentalisiert, und es ist kein Zufall, dass an jeder Ecke eine Stiftung für sie entsteht.[8] Diese Sonderbehandlung und die speziellen «Hilfen für Äthiopier*innen» stellen eine perfide Form der Ausgrenzung und Diskriminierung dar. Diese erstreckt sich auf fast alle Lebensbereiche.
Diskriminierung im Gesundheitswesen: Ein Beispiel hierfür ist die skandalöse Behandlung von Frauen äthiopischer Herkunft, denen ohne eine angemessene Aufklärung über einen längeren Zeitraum Mittel zur Empfängnisverhütung injiziert wurden.[9]
Diskriminierung im Schulwesen.[10] Es gibt im Land zahlreiche öffentliche Schulen, die nicht bereit sind, Schüler*innen äthiopischer Herkunft aufzunehmen. Zugleich wird ein unverhältnismäßig großer Anteil von Kindern äthiopischer Herkunft auf Sonderschulen geschickt (14 Prozent, was mehr als das Doppelte des allgemeinen Durchschnittswerts ist).
Diskriminierung im Bereich der Religion. Diese kommt unter anderem in der Weigerung lokaler Rabbiner zum Ausdruck, Menschen äthiopischer Herkunft zu verheiraten,[11] und in der fehlenden Anerkennung von Religionsgelehrten der äthiopischen Gemeinde.[12]
Diskriminierung im Wohnungsbereich. Wie bereits erwähnt, werden nur Einwanderer*innen aus Äthiopien in Israel dazu gezwungen, zwei Jahre lang nach ihrer Ankunft in Aufnahmezentren zu leben.[13] Zudem trägt die Politik durch eine selektive Gewährung von Wohnungszuschüssen zur Herausbildung von «äthiopischen Ghettos» bei.[14]
Diskriminierung in den Medien. Diese zeigt sich regelmäßig in einer stigmatisierenden Berichterstattung.[15]
Diskriminierung vonseiten der Polizei. Diese reicht von der systematischen und alltäglichen Schikane äthiopischer Jugendlicher durch Polizeibeamte[16] bis hin zum gewaltsamen Vorgehen der Polizei gegen Demonstrationen von Menschen äthiopischer Herkunft.[17]
Es gibt noch viele andere Beispiele, die hier aber aus Platzgründen nicht genannt werden können.
Über die Schwierigkeit der Solidarität und neue Verbindungen
Die Mitglieder der äthiopischen Community hängen verschiedenen politischen Überzeugungen an und vertreten keine einheitliche Position zur israelischen Regierungspolitik. Heute gibt es unter den Juden äthiopischer Herkunft Religiöse und Säkulare sowie Rechte und Linke. Im Gegensatz dazu tendierte die erste Generation der Einwanderer*innen eher ins rechte politische Lager – was damit zu tun haben kann, dass es am Ende eine Likud-Regierung war, die sie ins Land gelassen hat, während die Mapai-Regierungen die Existenz von jüdischen Menschen in Äthiopien lange verleugnet haben.

Die linken Bewegungen in Israel und die Kämpfe für Gerechtigkeit leiden oft unter internen Differenzen und Spaltungen. Die traditionelle Linke, die von (linken und rechten) kritischen Aktivist*innen als «weiße Linke» bezeichnet wird, neigt dazu, sich auf die (berechtigte) Forderung nach Gerechtigkeit für Nicht-Juden zu konzentrieren: vor allem Palästinenser*innen, Asylsuchenden und Arbeitsmigrant*innen. Gleichzeitig ignoriert sie die sozialen Probleme, unter denen arme jüdische Bevölkerungsgruppen leiden, die nicht zufällig auch dunkelhäutig sind: Mizrachim, Buchar*innen, aus dem Kaukasus stammende Menschen, Inder*innen und Äthiopier*innen – denn es gibt in Israel eine beunruhigende Korrelation zwischen sozialem Status und Herkunft. Seit der Staatsgründung wurden die genannten Bevölkerungsgruppen diskriminiert und erhielten nicht die gleichen Chancen wie die weiße aschkenasische Bevölkerung in Israel. Organisationen wie zum Beispiel die Demokratische Mizrachim-Regenbogen-Koalition, die feministische Mizrachi-Organisation Achoti – für Frauen in Israel und der Verband äthiopischer Jüdinnen und Juden sind aus diesen Communities hervorgegangen und arbeiten daran, das historische Unrecht auszugleichen, dessen Folgen wir noch heute sehen.
Die genannten Organisationen haben so gut wie keine Verbindungen zur «weißen Linken» in Israel, die es in der Vergangenheit versäumt hat, sich mit den institutionell diskriminierten Schichten der jüdischen Gesellschaft praktisch zu solidarisieren. Die Kluft vertiefte sich in den 1980er Jahren, als die Privatisierung der öffentlichen sozialen Dienste aggressiver vorangetrieben wurde und sich die sozioökonomische Krise erheblich verschärfte. Aber es gibt Beispiele für eine Zusammenarbeit. Der Kampf um die Anerkennung der Entführung von Kindern aus Familien, die aus dem Jemen, aus anderen «orientalischen» Ländern und vom Balkan nach Israel eingewandert sind, der durch Bemühungen der Großenkel dieser Einwanderer*innen wieder in die Schlagzeilen kam, wurde in den letzten Jahren überraschenderweise auch von vielen äthiopischen Aktivist*innen unterstützt. Die Kooperation zwischen den Aktivist*innen, die für die Freilassung von Avraham (Avera) Mengistu kämpfen, der seit Jahren im Gazastreifen verschwunden ist,[18] und denjenigen Gruppen, die sich für eine Anerkennung des Entführungsskandals einsetzen, ist eine der spannendsten gegenwärtigen politischen Verbindungen in Israel. Die umfangreiche Beteiligung äthiopischer Aktivist*innen am Kampf um die Anerkennung der Kindesentführungen zeugt meines Erachtens von der Diskriminierung, die die äthiopischen Aktivist*innen selbst erfahren haben. Ich bin fest davon überzeugt, dass nur Menschen, die selbst Diskriminierung erlebt haben, völlig verlässliche Partner im Kampf einer anderen Gruppe gegen Diskriminierung sein können. Eine solche Solidarität ist fast unerschütterlich, während die Solidarität von weißen privilegierten Gruppen dazu neigt, schwach und zerbrechlich zu sein. So ist meines Erachtens auch die Teilnahme des (palästinensischen) Knesset-Abgeordneten Ayman Odeh (Chadasch/Gemeinsame Liste)[19] an dem Protest von Menschen äthiopischer Herkunft gegen Polizeigewalt sehr viel mehr wert als die Beteiligung von Menschen, die solche Übergriffe vonseiten der Polizei nicht aus eigener Erfahrung kennen.
Ähnliche Formen der Zusammenarbeit zwischen zwei marginalisierten Gruppen lassen sich im Süden von Tel Aviv beobachten. Über viele Jahre hinweg haben es Hilfsorganisationen versäumt, etwas gegen die eklatante Vernachlässigung von Vierteln in diesem Teil der Stadt zu unternehmen. Das änderte sich erst, als dort viele Asylsuchende Unterschlupf fanden, die meisten davon aus dem Sudan und Eritrea. Als sich immer mehr von ihnen in der Umgebung des zentralen Busbahnhofs aufhielten, führte dies zu Protesten von alteingesessenen Bewohner*innen. Aber die Probleme dieser Gegend – die unzulängliche und veraltete Infrastruktur, die gesundheitliche Belastung durch den zentralen Busbahnhof sowie Prostitution und Drogen – haben nichts mit der Ankunft und Präsenz der Asylsuchenden zu tun. Es sind Probleme, die es dort schon lange gibt und die vonseiten der Stadtpolitik einfach ignoriert wurden. Erst jetzt, angesichts der Gefahr der Abschiebung der Asylsuchenden,[20] kommt es zu einer Zusammenarbeit zwischen Aktivist*innen, die sich mit den Geflüchteten solidarisieren, und denen, die für eine Verbesserung der Lebens- und Wohnsituation im Süden von Tel Aviv kämpfen. Aber es bestehen weiterhin Schwierigkeiten, diese Kämpfe aufeinander zu beziehen. Diese könnten auf einen Mangel an gegenseitigem Vertrauen zurückzuführen sein und auf die Angst der Privilegierten, ihre Vorrechte zu verlieren, sobald sie die systematische Unterdrückung schwarzer Menschen in der jüdischen Gesellschaft anerkennen.[21] Dazu scheint die weiße Gesellschaft immer noch nicht bereit zu sein.
Seit Beginn der Einwanderung von Jüdinnen und Juden aus Äthiopien nach Israel bis heute haben diese Rassismus und Diskriminierung in verschiedenen Bereichen erlebt, wobei die gravierendste meiner Meinung nach die institutionelle Diskriminierung ist, die in den 1950er Jahren begann und deren Auswirkungen bis heute spürbar sind. Seit 40 Jahren kämpfen Aktivist*innen und Organisationen von Menschen äthiopischer Herkunft gegen diese institutionelle Diskriminierung. Eine relativ große Gruppe von jungen und gut ausgebildeten Angehörigen der äthiopischen Community sind mittlerweile dabei, in die Zentren der Macht und der Entscheidungsfindung einzudringen und Veränderungen von innen voranzutreiben. Andere haben sich entschieden, außerhalb des Systems zu agieren. Es ist ein andauernder, tagtäglicher Kampf, der nicht aufhören wird, bis der israelische Staat beginnt, die Menschen äthiopischer Herkunft als Gleichberechtigte zu behandeln.
Hintergrund und Fakten zur äthiopischen Community in Israel
Die äthiopische Community zählt heute mehr als 150.000 Menschen, davon sind etwa 40 Prozent (zirka 60.000) Kinder und Jugendliche. 0,9 Prozent aller Student*innen in Israel sind äthiopischer Herkunft, während Menschen äthiopischer Herkunft über 1,5 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen. Die meisten Schüler*innen äthiopischer Herkunft besuchen staatliche religiöse Schulen. Der Anteil der Student*innen äthiopischer Herkunft, die ihr Studium abbrechen, liegt bei 19 Prozent, im Unterschied zu 11 Prozent, bezogen auf alle Studierenden.[22] Mehr als die Hälfte der Menschen äthiopischer Herkunft in Israel lebt unterhalb der Armutsgrenze. Mehr als ein Drittel hat kein Vertrauen in die Polizei, ein Wert, der in etwa auch für die palästinensischen Staatsbürger*innen gilt. Mehr als 40 Prozent der Menschen äthiopischer Herkunft vertreten die Ansicht, dass die Polizei oft Menschen in ihrer Umgebung ohne guten Grund verhaftet, während es unter den palästinensischen Staatsbürger*innen nur zirka 20 Prozent sind. Der Prozentsatz der Fälle, in denen Menschen äthiopischer Herkunft eine Straftat vorgeworfen bzw. ermittelt wird, liegt bei 3,5 Prozent – mehr als das Doppelte ihres Anteils an der Gesamtbevölkerung; und der Prozentsatz der Minderjährigen äthiopischer Herkunft, die Haftstrafen verbüßen, beträgt fast das Zehnfache ihres Anteils an der Gesamtbevölkerung. Im Ofek-Gefängnis, in dem nur Minderjährige inhaftiert sind, kommen zum Beispiel 18,5 Prozent aller Gefangenen aus Familien äthiopischer Herkunft.[23]
Meilensteine der Bewegung: Wichtige Kämpfe und Kampagnen
Wie im Text beschrieben, fand der erste große und vernetzte politische Kampf von Jüdinnen und Juden aus Äthiopien in den 1970er Jahren statt. Um das Recht auf Einwanderung durchzusetzen, trafen sie sich mit dem Oberrabbiner Ovadja Josef, jüdischen Aktivist*innen aus den USA, israelischen Regierungsbeamten und mit allen, die bereit waren, sie zu unterstützen.
Im Jahr 1983 und verstärkt nach 1985, nach der großen Einwanderung, die „Operation Moses“ genannt wurde, begannen Proteste gegen den staatlichen Zwang, an einem speziellen Verfahren zur Vorbereitung auf den Übertritt zum Judentum teilzunehmen. Infolge der Proteste wurden die strikten Regeln und Prozeduren der Konversion, die das Rabbinat in Israel den neuen Einwanderer*innen damals auferlegt hatte, aufgehoben.[24]
Im Januar 1996 wurde aufgedeckt, dass die Hilfsorganisation Magen David Adom, die im staatlichen Auftrag Blutspenden sammelt, Blutspenden, die von Menschen äthiopischer Herkunft kamen, ohne jeglichen Grund einfach vernichtet hat. Wenige Tage nach der Enthüllung dieses Vorgehens demonstrierten zirka 10.000 Menschen äthiopischer Herkunft vor dem Büro des Premierministers. Das war die bis dahin größte Protestaktion der aus Äthiopien stammenden Jüdinnen und Juden. Die Polizei ging mit exzessiver Gewalt gegen sie vor und setzte Gummigeschosse, Wasserwerfer und Tränengas ein. In den Medien wurde der Protest „die äthiopische Intifada“ genannt. Der leitende Polizeikommandant des Jerusalemer Bezirks bezeugte, dass dies die gewalttätigste Demonstration gewesen sei, die er je gesehen habe, und dass dies das erste Mal gewesen sei, dass die Polizei Tränengas gegen jüdische Demonstrant*innen eingesetzt habe. Außerdem hatte die Polizei wohl in Erwägung gezogen, zur Warnung mit scharfer Munition zu schießen.
Im Jahr 2015 kam es als Reaktion auf ein Video zu Protesten. Man sieht in dem Video zwei Polizisten, die mit brutaler Gewalt Damas Pikada, einen Soldaten äthiopischer Herkunft in Uniform, schlagen. Der Protest richtete sich gegen die Gewalttätigkeit der Polizei und vertrat die Forderung, die Polizisten, die Pikada verprügelt hatten, vor Gericht zu stellen. Tausende von Menschen äthiopischer Herkunft demonstrierten daraufhin in Jerusalem und Tel Aviv. Die Anführer*innen dieser Proteste waren nicht bereit, sich mit Regierungsvertreter*innen zu Verhandlungen zu treffen, und sie wiesen damit die Zuschreibung zurück, dass die aus Äthiopien stammenden Juden und Jüdinnen mit den Anführenden eine klare und tatsächlich repräsentative Vertretung hätten. Sie wurden beschuldigt, sich der radikalen Linken und den Anarchist*innen angeschlossen zu haben – womit implizit eine weitere Herabwürdigung verbunden war, weil die Annahme war, eine Demonstration dieser Größenordnung habe nicht allein von Menschen äthiopischer Herkunft organisiert werden können. Bereits 1980 hatte man Vertreter*innen der äthiopischen Community beschuldigt, sich mit US-amerikanischen anti-zionistischen Aktivist*innen gemein gemacht zu haben. Ähnlich wie 1996 ging die Polizei auch gegen die Demonstration im Mai 2015 in Tel Aviv mit völlig unverhältnismäßiger Gewalt vor, was von allen Seiten kritisiert wurde.[25]
Personen von Interesse
Josef Salamsa
Josef Salamsa wurde zum Gesicht der Proteste von 2015.[26] Im März 2014 war der junge Mann, der weder vorbestraft noch in anderer Form strafrechtlich jemals in Erscheinung getreten war, in Zichron Ja‘akow von Polizisten mit einer Elektroschockpistole angegriffen worden. Als seine Familie später in der Nacht zur Polizeiwache kam, fand sie ihn gefesselt auf der Erde am Eingang der Polizeiwache liegend vor. Aufgrund des Vorfalls fiel er in eine Depression und die Familie reichte eine Beschwerde bei der Einheit der Polizei für interne Ermittlungen ein. Die Beschwerde führte zu keiner Aufklärung. Stattdessen litt die Familie unter Schikanen von Polizist*innen, die erst endeten, nachdem Josef Salamsas Leiche im Juli 2014 gefunden wurde. Versuche, die Umstände seines Todes zu klären, blieben erfolglos.
Avera Mengistu
Am 7. September 2014 überquerte Avera Mengistu, ein Israeli äthiopischer Herkunft, die Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen.[27] Bis heute wird er von der Hamas gefangen gehalten. Daraufhin verhängte die israelische Regierung eine sogenannte Gag-Anordnung (Redeverbot) und schrieb vor, dass ein Jahr lang nicht über sein Verschwinden berichtet werden durfte. Gleichzeitig hat der israelische Staat nichts unternommen, um seine Freilassung zu erwirken. Der Fall gelangte weder auf die öffentliche noch auf die politische Tagesordnung. Schlimmer noch: Der Familie wurde vom zuständigen Mitarbeiter des Premierministers gedroht. Ihnen würde jegliche Hilfe der Regierung entzogen, sollten sie den israelischen Staat für sein Vorgehen in dieser Angelegenheit kritisieren oder eine Verbindung zwischen diesem Fall und der institutionellen Diskriminierung der äthiopischen Community in Israel herstellen. Die Familie schwieg, wie gefordert, für ein Jahr und versuchte, hinter den Kulissen zu agieren, bis sie verstand, dass die staatlichen Stellen nichts Wesentliches unternahmen. Premierminister Benjamin Netanjahu traf sich mit der Familie erst nach Ablauf der Gag-Anordnung im Juli 2015, also ein Jahr nach Avera Mengistus Verschwinden. Wenn man den Fall von Avera Mengistu mit dem des entführten israelischen Soldaten Gilad Schalit vergleicht, ist der Unterschied in der politischen und öffentlichen Einstellung unübersehbar.
Übersetzt von Ursula Wokoeck Wollin
Efrat Yerday ist in Aschdod geboren und lebt in Beer Sheva. Sie lehrt und forscht an der Ben-Gurion-Universität mit den Schwerpunkten Geschichtsnarrative, Rassismus und die Marginalisierung von People of Color in der israelischen Gesellschaft. Sie ist Aktivistin und leitet das Forschungsprojekt „A Story Rewritten: Ethiopian Jews Rewriting Their Story“ am Van Leer Jerusalem Institute. Efrat schreibt regelmäßig als Kolumnistin für die Tageszeitung Haaretz und für verschiedene Blogs.
Weiterführende Links
Ella Shohat - Mizrachim in Israel: Zionismus aus der Sicht seiner jüdischen Opfer
Naama Katiee - Der Skandal um die verschwundenen Kinder
Assia Istoshina - Die mysteriöse russische Seele
„Jeder Polizist weiß, dass er mit uns alles machen kann" - Interview mit Tigist Mahari
Zvi Ben-Dor Benite - Zwischen Ost und West - Die Mizrachim
Tali Konas - Sallah, das ist Eretz Israel
Anmerkungen
[1] Das bedeutet, dass Israel als eine Insel der Zivilisation inmitten der "Barbarei" gesehen wird. Die Formulierung "Villa in der Dschungel" stammt vom ehemaligen Premierminister Ehud Barak und erfreut sich seit Anfang der 2000er Jahre großer Popularität. Sie kann als Neuauflage oder Variation von Theodor Herzls Vorstellung von der Rolle Israels gesehen werden, die er in seinem Buch "Der Judenstaat" (1896) beschrieben hat: „Wir werden für Europa ein Bollwerk gegen Asien bilden und als Hüter der Kultur gegen die Barbarei dienen.“
[2] Falasche ist eine abwertende, ursprünglich in Äthiopien verwendete Bezeichnung für die lokale jüdische Bevölkerung, die sich selbst als Beta Israel (Haus Israel) bezeichnete. Falaschen bedeutet in etwa landlose Migrant*innen und ist vergleichbar mit der Bezeichnung "Zigeuner" in Europa.
[3] Der Jüdische Weltkongress wurde 1936 als internationale Vereinigung von jüdischen Gemeinden und Organisationen gegründet, mit dem Anspruch, die politischen Belange aller Jüdinnen und Juden in der Diaspora zu vertreten.
[4] Die orthodoxe Strömung ist eine der vier Strömungen des Judentums in der Moderne. Sie entwickelte sich im 19. Jahrhundert in Europa als Gegenströmung zum neu entstehenden Reformjudentum. Seit der Staatsgründung ist die orthodoxe Strömung die einzig offiziell anerkannte Strömung des Judentums in Israel.
[5] Die national-religiöse Bewegung, die auch religiöser Zionismus genannt wird, verbindet Zionismus mit orthodoxem Judentum. Menschen, die dieser Strömung angehören, dienen in der Regel in der israelischen Armee und befürworten häufig den Siedlungsbau in den seit 1967 besetzten palästinensischen Gebieten. Politisch fand diese Strömung lange Zeit vor allem in der National-Religiösen Partei ihren Ausdruck. Gegenwärtig wird sie vor allem von der von Naftali Bennett geleiteten Partei HaBajit haJehudi vertreten.
[6] Schtetl ist die jiddische Bezeichnung für eine kleine Stadt mit überwiegend jüdischer Bevölkerung. Da die Mehrheit der jüdischen Bevölkerung in Mittel- und Osteuropa in solchen „kleinen Städten“ lebte, hatte dies einen prägenden Einfluss auf die dortige jüdische Kultur.
[7] In den achtziger und neunziger Jahren wanderten alle Mitglieder der Beta-Israel-Gemeinschaft, die nach einem Kampf vom Staat Israel als Juden anerkannt wurden, aus Äthiopien nach Israel ein. Diejenigen, die in Äthiopien blieben, sind die Falashmura, Nachkommen der Gemeinschaft des "Beta Israel", die aufgrund der Umstände der Zeit und der Umgebung zum Christentum übergetreten sind, aber dennoch ihre jüdischen Traditionen bewahrt haben. Die literarische Bedeutung des Begriffs "Falashmura" ist einen Philister, der zum Christentum konvertierte. Die beiden Gemeinschaften haben gemeinsame Familien- und Ehebindungen.
Die jüdische äthiopische Gemeinschaft kämpft bis heute dafür, dass die Falashmura nach Israel einwandern dürfen.

[9] Vgl. www.haaretz.com/israel-news/.premium-ethiopians-fooled-into-birth-control-1.5226424.
[10] Vgl. www.iaej.co.il/?page_id=15279&lang=en; https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-report-educational-programs-still-segregating-ethiopian-israelis-1.5461366.
[11] Vgl. www.timesofisrael.com/ethiopians-unable-to-wed-in-petah-tikva-where-rabbis-doubt-their-jewishness/.
[12] Vgl. www.jpost.com/Israel-News/Govt-approves-recognition-of-Ethiopian-religious-leaders-543034.
[13] Vgl. https://972mag.com/how-the-jewish-agency-is-throwing-ethiopian-immigrants-onto-the-street/109039/.
[14] Vgl. www.iaej.co.il/?page_id=15282&lang=en.
[15]Vgl. http://frenchjournalformediaresearch.com/index.php?id=967.
[16]Vgl. www.haaretz.com/opinion/.premium-israel-is-a-racist-country-take-it-from-an-ethiopian-israeli-1.5403332.
[17] Vgl. www.haaretz.com/israel-news/.premium-panel-police-should-stop-using-stun-guns-in-areas-with-many-ethiopians-1.5419209.
[18] Seit September 2015 ist der israelische Staatsbürger Avraham Mengistu im Gazastreifen verschwunden und in die Hände der Hamas geraten. Der Fall verstrickte die israelische Regierung in eine politische Debatte, in der es auch um Rassismus geht: Mengistus Bruder wirft der Regierung vor, sich nicht ausreichend für seine Freilassung einzusetzen, weil Mengistu ein Jude äthiopischer Herkunft ist.
[19] Für weitere Informationen zu Ayman Odeh und zur Gemeinsamen Liste siehe www.rosalux.org.il/gemeinsam-anders-die-gemeinsame-liste-und-progressive-politik-in-israel/.
[20] Mehr dazu unter www.rosalux.org.il/schwerpunkt-gefluchtete-israel/.
[21] Ein Artikel der Autorin zu diesem Thema findet sich unter www.haaretz.com/opinion/.premium-they-didn-t-want-ethiopian-jews-in-israel-either-1.5785804.
[22] Vgl. hierzu den 2013 veröffentlichten staatlichen Bericht unter www.mevaker.gov.il/(X(1)S(5qggy4mioofhxebutrfuvgio))/he/Reports/Pages/114.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1.
[23] Vgl. hierzu den aktuellen Bericht des israelischen Justizministeriums (2016) unter www.justice.gov.il/Pubilcations/Articles/Documents/ReportEradicateRacism.pdf.
[24] Die Forderung, das Konversionsverfahren wieder strenger zu gestalten, ist in den letzten zehn Jahren lauter geworden. Sie steht im Zusammenhang mit der Einwanderung aus Äthiopien von Menschen, die zu den Falaschamura gehören und zum Teil mit Menschen verwandt sind, die zu der Beta-Israel-Gemeinde gehören. Es ist wichtig anzumerken, dass auch Einwanderer*innen aus Osteuropa im Rahmen von Familienzusammenführungen nach Israel kommen, darunter auch Menschen, die sich selbst nicht als jüdisch bezeichnen. Von Migrant*innen aus Osteuropa wird aber nicht verlangt, dass sie eine Prozedur der Konversion durchlaufen, um zu „richtigen“ Einwanderer*innen zu werden.

[26] Vgl. https://972mag.com/israels-police-have-a-taser-problem/124501/.
[27] Vgl. https://edition.cnn.com/2015/08/27/middleeast/israel-avera-mengistu-missing-one-year/index.html.
Download PDF